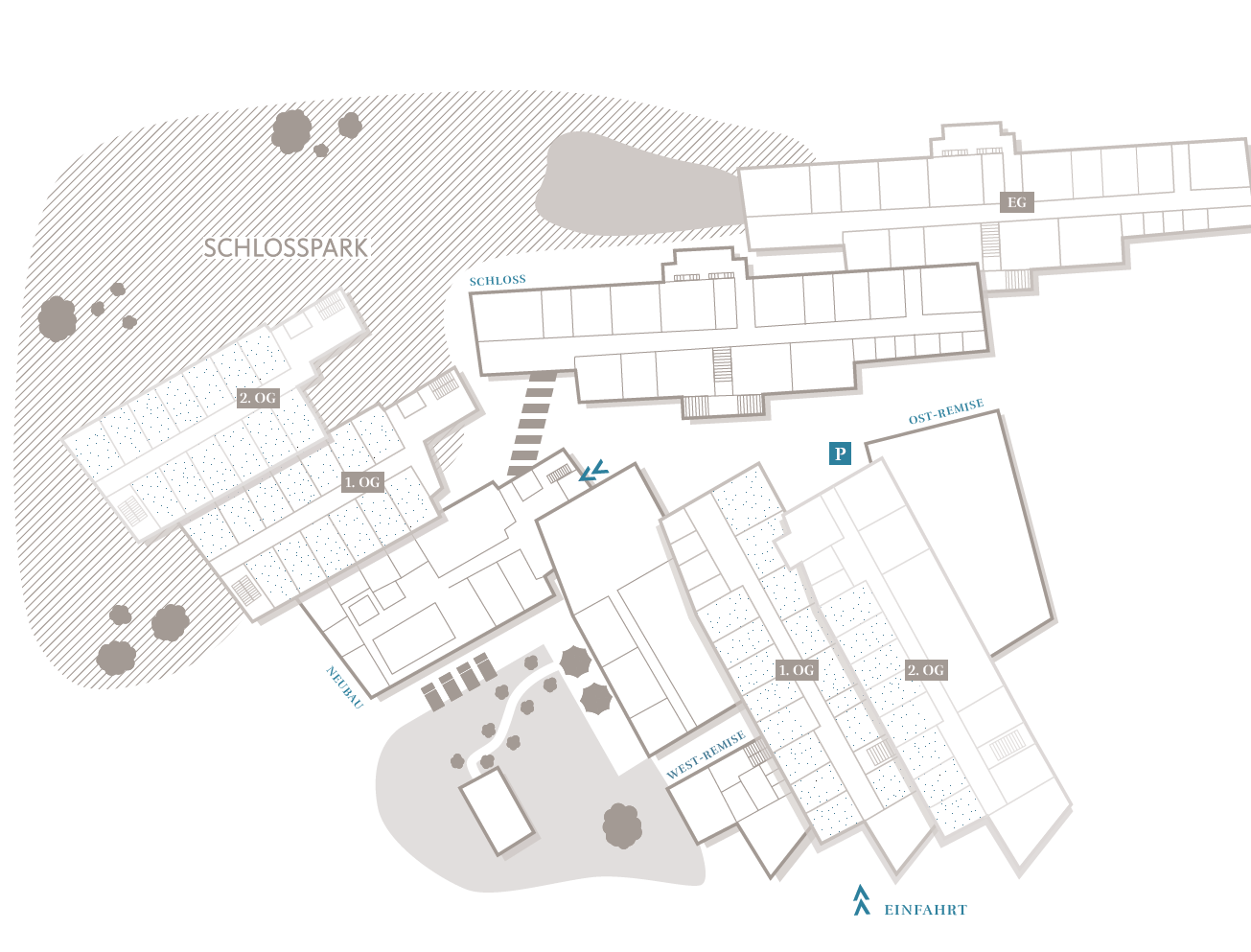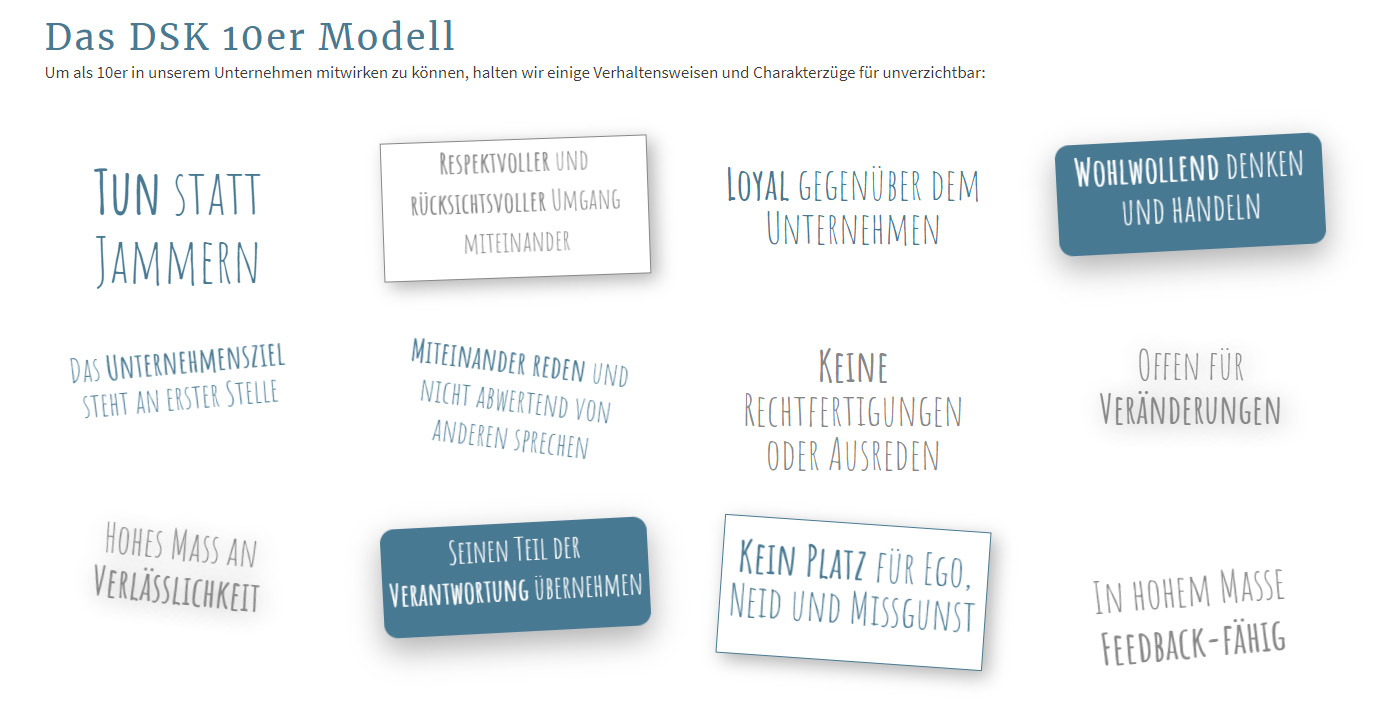Intensive Arbeitsphasen sind Teil eines ambitionierten Lebensstils – und für viele selbstverständlich. Doch wenn die Arbeit zunehmend zur alleinigen Bezugsquelle für Sinn, Identität oder Wertschätzung wird, kann daraus eine Abhängigkeit entstehen. Wo aber verläuft die Grenze zwischen produktivem Einsatz und einem Verhalten, das mehr und mehr von innerem Druck gesteuert wird und langsam in Arbeitssucht abgleitet?
Die Beschreibung Workaholic wird im allgemeinen Sprachgebrauch oft verharmlosend verwendet. Dabei bezeichnet sie ein Verhalten, das klare Parallelen zu suchthaftem Erleben aufweist. Ähnlich wie bei substanzgebundenen Süchten wird ein Zustand der Anspannung und Erfüllung über ein bestimmtes Verhalten reguliert – in diesem Fall Arbeit. Für Außenstehende, etwa Kollegen oder Freunde, ist das nicht immer sofort erkennbar. Denn nicht selten beginnt eine Arbeitssucht genau dort, wo von außen alles nach Erfolg aussieht.
Besonders gefährdet sind Selbstständige, Führungskräfte und Manager, Politiker oder Prominente. Auch in helfenden Berufen, etwa bei Ärzten, Lehrkräften oder sozial Arbeitenden, tritt Arbeitssucht auf.
Zwischen Leistungsbereitschaft und Kontrollverlust
Was sind Anzeichen einer Arbeitssucht? Angenehme, anfänglich positive Effekte – etwa Anerkennung durch Mehrleistung – schwächen sich mit der Zeit ab. Stattdessen tritt bei „Arbeitsentzug“ (zum Beispiel am Feierabend, am Wochenende oder im Urlaub) ein Gefühl von Unruhe oder Unwohlsein auf. Pausen wirken dann nicht erholsam, sondern bedrohlich. Und Ruhe wird zum Auslöser von Unruhe.
Auch wenn Arbeitssucht derzeit nicht als offiziell anerkannte Krankheit im medizinischen Sinne geführt wird, zeigen sich bei Betroffenen typische Merkmale eines nicht-stoffgebundenen Suchtverhaltens.
- nicht funktionaler Perfektionismus
- von inneren Zwängen getriebenes übergroßes Arbeitspensum
- zunehmend Drang nach Dosissteigerung
- Kontrollverlust
- Überhöhung der eigenen Leistungsfähigkeit
- Ignorieren von Signalen der Überlastung
- Rückzug von sozialen Kontakten
- Emotionale Abstumpfung
- Schlafprobleme
Ursachen und Mechanismen der Arbeitssucht

Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für die Entstehung von Arbeitssucht. Manche Menschen entdecken beispielsweise in einer Krise eher zufällig das „Suchtmittel“ Arbeit, das belastende Zustände kurzfristig tatsächlich zu lindern scheint. Was anfangs als funktionaler Ausweg wirkt, entwickelt sich jedoch zunehmend zu einem Zwang. Die gesellschaftliche Aufwertung von harter und übermäßiger Arbeitsbelastung ist ebenfalls ein Risikofaktor (Stichwort: Workaholic). Hinzu kommt die Verfügbarkeit: Laptop, Internet, Smartphone und Homeoffice machen Arbeit unabhängig von Zeit und Ort. Man ist permanent abrufbar.
Die Ursachen einer Arbeitssucht können sehr unterschiedlich sein. Häufig wirken mehrere Faktoren gleichzeitig:
- Der Wunsch, als unentbehrlich wahrgenommen zu werden
- Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen oder Verantwortung abzugeben
- Der Versuch, Selbstwert über Leistung zu stabilisieren
- Äußere Erwartungen, die verinnerlicht wurden und nicht hinterfragt werden
- Die Suche nach Kontrolle in einem komplexen Alltag
Oft geschieht dies unbewusst. Erst mit Abstand lässt sich erkennen, welche Mechanismen am Werk sind – und welche davon langfristig nicht tragfähig sind.
Phasen einer Arbeitssucht – schleichend und ernstzunehmend
Die Entwicklung einer Arbeitssucht verläuft meist in Stufen, die sich nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen:
- Anfangsphase: Arbeit wird zum bestimmenden Lebensinhalt. Sie verschafft Energie, Anerkennung und Erfolg – das Verhalten wird belohnt. Man verschanzt sich hinter beruflichen Aufgaben. Mitmenschen, eigene Interessen und sonstige Pflichten werden vernachlässigt.
- Kritische Phase: Erste Konflikte mit dem privaten Umfeld, soziale Rückzüge, ständiges Denken an die Arbeit, auch in der Freizeit. Arbeitsaufgaben werden gehortet, zunehmend aber nicht mehr bewältigt. Erste Folgeerscheinungen treten auf, etwa körperliche und seelische Erschöpfung bei gleichzeitigen Schlafproblemen.
- Chronische Phase: Immer mehr Arbeit wird übernommen. Das Privatleben verliert an Bedeutung. Die Arbeitssucht führt zu Kräfteverschleiß, hohem Stresslevel und fehlender Regeneration. Anhaltende Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Erschöpfung und körperliche Beschwerden häufen sich – oft begleitet von innerer Leere. Ängste und Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Störungen können hinzukommen. Im fortgeschrittenen Stadium einer Arbeitssucht tritt an die Stelle echter Produktivität oft nur noch der Anschein von Aktivität – etwa durch das wiederholte Abrufen von Mails, Nachrichten oder das ziellose Surfen im Netz. Es sind leerlaufende Rituale, die Beschäftigung simulieren, ohne substanzielle Ergebnisse zu erzeugen.
- Endphase: Die Leistungsfähigkeit knickt massiv ein. Mit fortgeschrittener Arbeitssucht sinkt die Fähigkeit bei Betroffenen zur Einsicht, es wächst die Abwehr und Selbstverleugnung. Akute Symptome wie Schwitzen, Pulsrasen, Zittern, erhöhter Blutdruck und Schwäche treten auf, es drohen lebensgefährliche Erkrankungen wie Herzinfarkt, aber auch Suizidtendenzen. Es kann sogar zum plötzlichem Stresstod kommen, der in Japan mit „Karoshi“ einen eigenen Namen bekam.
Perspektive – Veränderung ist möglich
Ein Suchtverhalten zieht oft weitere nach sich: Das falsche Selbstbild des Arbeitssüchtigen ist oft nur durch Gebrauch von Alkohol, Medikamenten oder Drogen aufrecht zu erhalten. Eine weitere Bedrohung entsteht. Arbeitssucht muss zum Kollaps führen. Dieser vermeintliche Worst Case aus Sicht des Betroffenen ist zugleich seine Chance. Arbeitssucht ist ein veränderbares Muster. Der erste Schritt liegt meist im Erkennen. Die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten schafft die Grundlage für neue Strategien im Umgang mit Arbeit, Leistung und Erholung.
Therapeutische Optionen – strukturiert, diskret und wirksam
Ein stabilisierender Rückzug aus dem Alltag kann helfen, das eigene Verhalten besser einzuordnen. Welche Form der Begleitung sinnvoll ist, hängt vom aktuellen Zustand ab. Möglich sind:
- Ambulante Unterstützung im Rahmen regelmäßiger Gespräche
- Tagesklinische Settings, die Therapie und Alltag miteinander verzahnen
- Stationäre Behandlungen, insbesondere bei hohem Erschöpfungsgrad oder akuten psychosomatischen Beschwerden
Ein solcher Schritt erfordert oft Mut – ist aber zugleich eine Investition in Klarheit, Gesundheit und zukünftige Leistungsfähigkeit.
Strategien im Umgang mit Arbeitssucht
In frühen Phasen können konkrete Maßnahmen helfen, das eigene Verhalten zu stabilisieren und Grenzen neu zu definieren:

- Klare Trennung von Beruf und Privatleben: Keine Arbeit mehr zu Hause erledigen.
- Grenzen setzen: „Nein sagen“ lernen und Prioritäten bewusst steuern.
- Erholung fest einplanen: Pausen, freie Tage und Urlaube konsequent nehmen.
- Arbeitszeiten regulieren: Sich an reguläre Pflichtarbeitszeiten halten.
- Aufgaben delegieren: Im Austausch mit Kollegen bleiben und Verantwortung abgeben.
- Stressmanagement trainieren: Entspannungsübungen und Techniken zur Stressbewältigung anwenden.
- Ausgleich schaffen: Regelmäßig Sport treiben und Zeit in der Natur verbringen.
Ein unterstützendes Coaching kann wertvolle Impulse geben.
In fortgeschritteneren Stadien reichen solche Schritte jedoch nicht mehr aus. Dann wird häufig eine längere Krankschreibung notwendig, vergleichbar mit einem Entzug bei substanzgebundenen Süchten. Je nach individuellem Zustand können eine ambulante Psychotherapie, ein tagesklinisches Setting oder auch ein stationärer Aufenthalt erforderlich sein. Besserungen stellen sich meist erst über einen längeren Zeitraum ein, da die Hintergründe der Arbeitssucht zunächst klarer herausgearbeitet werden müssen.
Langfristig geht es darum, alternative Strategien zu entwickeln: Wer bisher ausschließlich über Arbeit Selbstbestätigung gefunden hat, kann lernen, neue Quellen für Wertschätzung und Sinn im Leben zu erschließen. Das Eingeständnis der eigenen Arbeitssucht mag zunächst auf Widerstand stoßen, weil es mit Stolz und Selbstbild kollidiert. Doch Einsicht eröffnet den Weg, das Muster als ernstzunehmende, aber veränderbare Verhaltensstörung zu verstehen – und gezielt an einer nachhaltigen Veränderung zu arbeiten. So lässt sich ein Lebensstil etablieren, der Verantwortung, Engagement und Gesundheit nicht als Gegensätze versteht, sondern als integrierbare Elemente eines stabilen Selbstverständnisses.
Hinweis der Redaktion: Dieser Beitrag erschien erstmals am 29. März 2023 und wurde aktualisiert.