Veränderungen im Charakter oder im Verhalten
Psychische Erkrankungen gelten als persönlichkeitsverändernd. Diese These kann jedoch nicht verallgemeinert werden, da die Bandbreite von Depression, Burnout, Angsterkrankungen und anderen psychischen Erkrankungen so vielfältig ist wie die Persönlichkeiten der Menschen selbst.
Wichtig ist daher die Unterscheidung, ob die Erkrankung selbst, Einflüsse von Medikamenten oder das Verhalten im Rahmen des Genesungsprozesses im Mittelpunkt der Veränderung steht. Die wertungsfreie Akzeptanz der Veränderung kann für den Erkrankten und die Angehörigen gleichermaßen zur Belastungsprobe werden.
Veränderungen im Charakter oder im Verhalten?
Der Charakter eines Menschen gilt in der Psychologie als unveränderlich. Er wird auf der Basis der Veranlagung in jungen Jahren zu einer individuellen Persönlichkeit geprägt. Einfluss darauf nehmen in den ersten Lebensjahren das Umfeld und daraus resultierende Erfahrungswerte. Der Eindruck, ein Mensch würde sich aufgrund einer psychischen Erkrankung verändern, ist somit weniger mit dem Charakter oder gar einer Charakterschwäche, sondern mit dem Verhalten und den Reaktionen des Erkrankten in Verbindung zu bringen. Die Basis der Veränderung findet sich in der Fähigkeit, sich den Bedingungen des Umfeldes anzupassen.
Ein gesunder, erwachsener und reifer Mensch besitzt die sogenannte Resilienz. Dies bezeichnet die Fähigkeit, sich an sein Umfeld anzupassen und widrigen Umständen sowie Problemen Lösungen entgegenzusetzen. Beim Auftreten von psychischen Erkrankungen ist der Körper und die Psyche durch die Erkrankung belastet, wodurch die Fähigkeit zur Resilienz sinkt. Der betroffene Mensch wird somit schneller traurig, ungeduldig, wütend, mitunter sogar aggressiv und tritt seinem Umfeld mit einem veränderten Verhalten entgegen. Diese Verhaltensveränderung sollte wertungsfrei betrachtet werden, da sie ein Anzeichen der Erkrankung oder eine Nebenwirkung von Medikamenten sein kann. Auch im Verarbeitungsprozess von Erlebnissen, beispielsweise im Rahmen einer Therapie mit Blockadenlösung, kann ein verändertes Verhalten auftreten.
Unterstützung und Hilfestellung für Angehörige
Angehörige, oft aber auch der Patient selbst, stehen den Veränderungen je nach individueller Ursache hilflos oder unsicher gegenüber. Beobachtungen sollten daher stets dem Behandler mitgeteilt werden. Besonders wichtig ist dabei die Einsicht des Patienten, aber auch das Verständnis der Angehörigen. Dieses Verständnis sollte jedoch nicht mit uneingeschränkter Akzeptanz verwechselt werden: Wird der Patient im Rahmen der Verhaltensveränderung aggressiv gegenüber sich oder seinen Angehörigen, sollte zeitnah ein Gespräch mit dem Behandler erfolgen.
Unsere Tipps für Angehörige:
Geduld und Verständnis
Ein Mensch mit einer Depression oder einer Angsterkrankung kann sein Verhalten je nach Schwere der Erkrankung nicht selbst steuern. Antriebslosigkeit ist somit keine Faulheit, Gereiztheit kein gezielter Angriff und Unverständnis zu Ihrem Empfinden keine Böswilligkeit. Versuchen Sie unbedingt, das Verhalten des Erkrankten nicht persönlich zu nehmen, und bemühen Sie sich um innere, notfalls auch körperliche, Distanz.
Selbstfürsorge
Der Wunsch, für den Erkrankten da zu sein, darf nicht zu mangelnder Selbstfürsorge führen. Gerade wenn Ihr Angehöriger viel Geduld von Ihnen fordert, sollten Sie sich regelmäßige Auszeiten für Ihre eigenen Energiereserven vorbehalten.
Aufmerksamkeit auf das „Hier und Jetzt“ lenken
Bei psychischen Erkrankungen übermannt so manchen Patienten die Hoffnungslosigkeit gegenüber einer Besserung der Situation und der Genesung. Hören Sie ihm/ihr zu, unterstützen Sie die Entwicklung neuer Perspektiven und Blickwinkel, ohne die aktuelle Gefühlslage gering zu reden oder zu überbewerten. Regen Sie den Betroffenen an, die Aufmerksamkeit möglichst auf konkrete Tätigkeiten, um den Fokus auf Fakten statt auf Empfindungen zu lenken. Bevorzugen Sie lösungsorientierte Themen gegenüber Problemgrübelei, ohne die Belastung durch die Erkrankung zu verleugnen.
Unterstützung im Alltag
Geben Sie dem Betroffenen Hilfestellung im Alltag, ohne ihm alle Aufgaben abzunehmen. Motivieren Sie zum gemeinsamen Agieren, insbesondere bei der Einhaltung von Tagesroutinen, Medikamenteneinnahmen, der Körperpflege sowie bei leichten Hausarbeiten.
Erkrankte können Ihren Angehörigen umgekehrt helfen, wenn Sie möglichst offen über Gefühle und Empfindungen sprechen und die Erkrankung als solche anerkennen. Bemühen Sie sich um Distanz gegenüber Schuldgefühlen. Nehmen Sie Abstand von Vorwürfen gegenüber dem Umfeld. Versuchen Sie, in guten Phasen Ihre Gedankenwelt in Worte zu fassen oder bitten Sie Ihren Therapeuten um die Einbindung der Angehörigen, um ein besseres Verständnis auf beiden Seiten herbeizuführen.

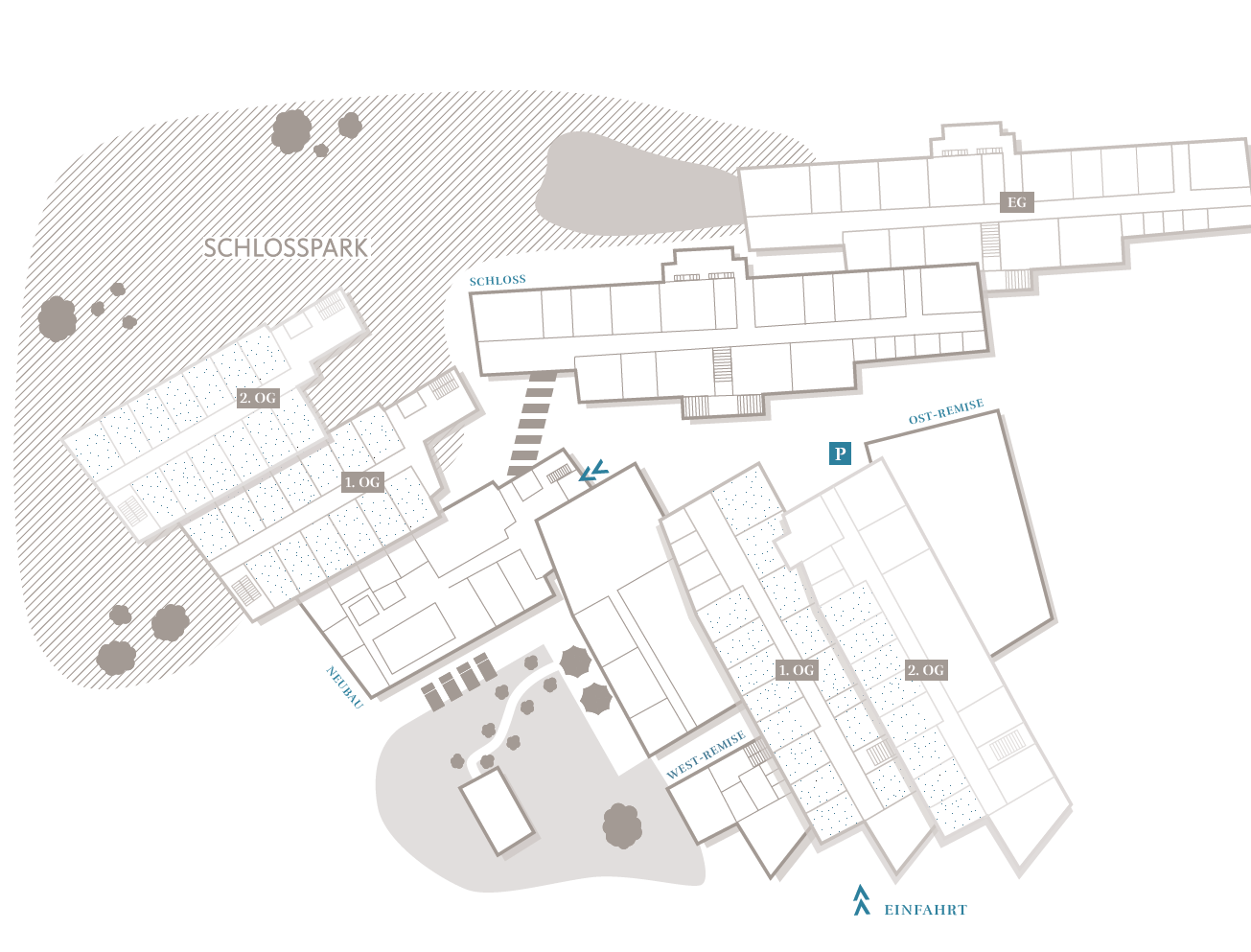

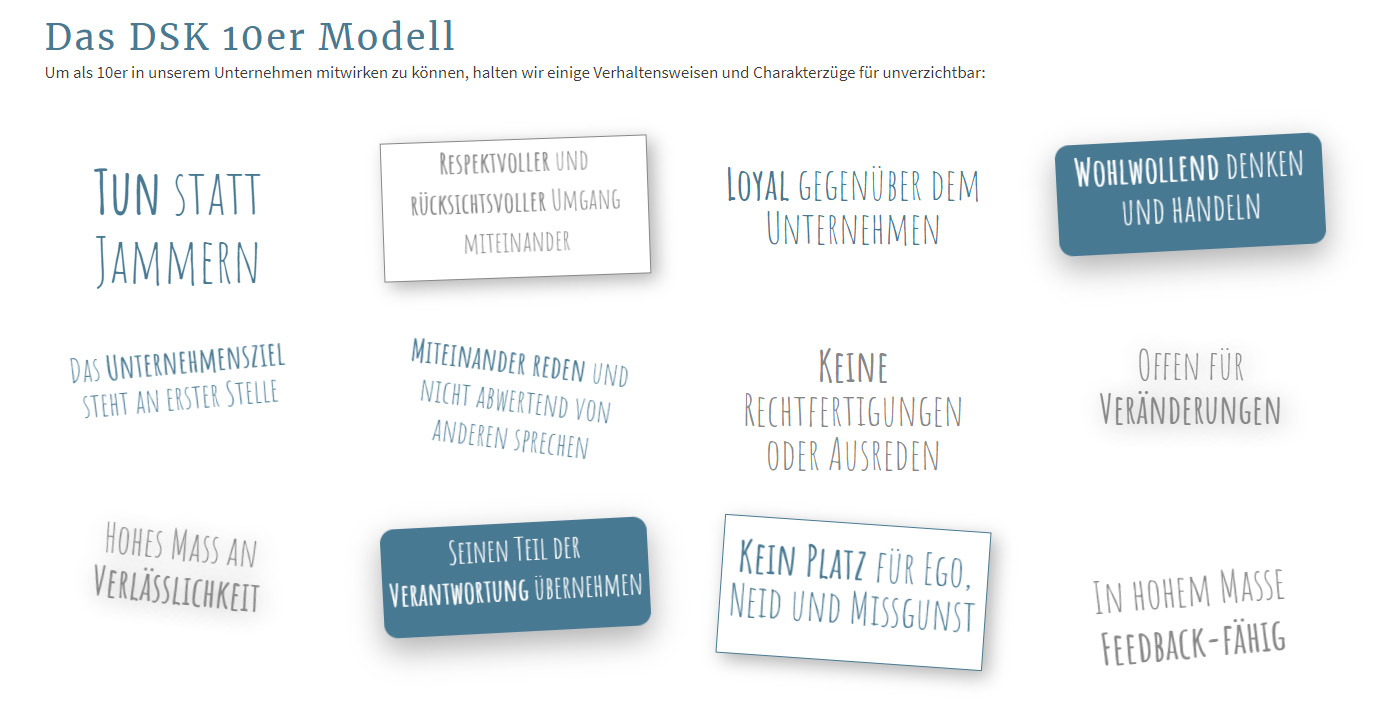




Sehr geehrtes Team, als 79-jähriger „Psycho-Somatiker“ habe ich fast mein ganzes Leben an meinen und den Unzulänglichkeiten Anderer gelitten. Nach vielen Therapien bin ich zur Einsicht gekommen, daß irgendwann die Eltern nicht mehr daran schuld sein können. Eine Frage bleibt: „Inwieweit ist der Charakter bei einem „gesunden“ Menschen schuld an seinen Handlungen? Ein ängstlicher Mensch wird in einer – für ihn – extremen Situation mit Flucht reagieren. Ein progressiv-aggressiver Mensch tritt eher die Flucht nach Vorne an: „Bevor ich untergehe, nehme ich noch Einige mit!“
Erst heute fühle ich mich weitestgehend gefestigt, habe ein gutes Selbstbewusstsein und werde von Leuten „bewundert“, was ich in meinem Alter noch bewege.
Ihre Info ist selbst für psycho-therapeutisch „Halbgebildete“ sehr verständlich und hat mich zum Denken angeregt. Weiter so!
Vielen Dank für den Erkenntnisgewinn und freundliche Grüße
Gerd Wenninger